Kapitelübersicht
Hafen HamburgAn den Schalthebeln der FrachtHamburg, Deutschlands zweitgrößte Stadt, ist mit dem Hafen zu dem geworden, was sie ist: ein Tor zur Welt. Aber steht es noch offen? Was kommt durch dieses Tor? Was geschieht dahinter? Eine Reportage in 14 Kapiteln; eine Geschichte vom Wandel: von Menschen und Containern, von hochfliegenden Plänen und der Arbeit im Schlamm.
KapitelübersichtSie können durch die gesamte Geschichte scrollen oder einzelne Kapitel direkt ansteuern.

I. Ein Schiff wird kommen
Kapitel IEin Schiff wird kommen
11 000 000
Bananen werden im Schnitt täglich am O‘Swaldkai entladen, im Jahr 500 000 Tonnen – damit ist Hamburg Deutschlands Bananenhauptstadt
219
Mal liefen Kreuzfahrtschiffe im Jahr 2018 Hamburg an, das größte war am Kreuzfahrtterminal Steinwerder die MSC »Meraviglia«, die Platz für mehr als 5700 Passagiere zu bieten hat
90
Straßenbrücken gibt es im Hamburger Hafen, dazu 51 Bahnbrücken. Die höchste ist die Köhlbrandbrücke mit einer lichten Höhe von 53 Metern
1 800 000
Zeilen Programmcode waren zu schreiben, um per Computer das Container-Terminal Altenwerder (CTA) zu steuern. Das CTA ist weitgehend automatisiert und gilt als eines der modernsten Terminals weltweit
2563
Menschen lebten laut Volkszählung 1951 in Hamburg-Altenwerder. Inzwischen steht vom ehemaligen Dorf nur noch die Kirche St. Gertrud; die Bewohner wurden umgesiedelt, um Platz zu machen für die Hafenerweiterung
103
Nationen gehörten im vergangenen Jahr die Gäste der Seemannsmission Duckdalben an. Seit der Eröffnung 1986 haben Helfer mehr als eine Million Besucher betreut, meist Seeleute
24
Stunden vor Ankunft müssen Seeschiffe bei der Nautischen Zentrale angemeldet werden, größere Schiffe sogar drei bis fünf Tage im Voraus. 27 Nautiker kontrollieren hier den Schiffsverkehr
3 500 000
Holzpfähle, verankert im Elbschlick, tragen die Gebäude der Speicherstadt. 1888 eingeweiht, stehen die Backstein- und Klinkerbauten seit 1991 unter Denkmalschutz
866
Millionen Euro hatte der Bau der Elbphilharmonie gekostet, als sie 2016 endlich fertig war – mehr als sechs Jahre später als geplant. Und mehr als elfmal teurer
512
GEO-Ausgaben sind seit Oktober 1976 (Erstausgabe) erschienen. Die GEO-Redaktion sitzt in Hamburg am Baumwall, direkt am Ufer gegenüber dem Hafen
426,5
200 000
Schmuggelzigaretten entdecken Zollbeamte dank der Container- Röntgenanlage in Waltershof im Schnitt jeden Tag(!)
28
Prozent: Um so viel brach der Containerumschlag am Hamburger Hafen von 2008 auf 2009 ein – eine Folge der Finanzkrise. Von diesem Rückgang hat sich der Hafen, hier der Burchardkai, bis heute nicht komplett erholt
115 000
Fahrzeuge fahren täglich auf der Bundesautobahn A 7 durch den Neuen Elbtunnel – wenn nicht gerade wieder eine der vier Tunnelröhren wegen Sanierung für den Verkehr gesperrt ist
15,10
Meter beträgt der maximale Tiefgang für große Schiffe. Sie können nur mithilfe der Flut durch die Elbe einfahren. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut beträgt auf der Höhe von St. Pauli im Schnitt 3,79 Meter, obwohl der Hafen 110 Kilometer vom offenen Meer entfernt ist
Mehr als 50 Interviews und Gespräche, Dutzende Ortsbegehungen: Für den ehemaligen GEO-Chefreporter und späteren GEO-Chefredakteur Peter-Matthias Gaede war ausgerechnet die Geschichte vor der Haustür die aufwendigste seiner Karriere. Seine Mammut-Recherche dokumentierte er mit Hunderten Handy-Bildern, über einige davon berichtet er im Audiokommentar.
II. Container
Kapitel IIContainer
III. In der Wärmestube
Kapitel IIIIn der Wärmestube
IV. Am Dirigentenpult
Kapitel IVAm Dirigentenpult
V. Die Abfangjäger
Kapitel VDie Abfangjäger
VI. Die Saubermänner
Kapitel VIDie Saubermänner
VII. Im Tunnel
Kapitel VIIIm Tunnel
VIII. Erschütterungen ganz oben
Kapitel VIIIErschütterungen ganz oben
IX. Die Unsichtbaren
Kapitel IXDie Unsichtbaren
X. Der Schlepper
Kapitel XDer Schlepper
XI. Nostalgie
Kapitel XINostalgie
XII. Die Manager
Kapitel XIIDie Manager
XIII. Der Endemit
Kapitel XIIIDer Endemit
XIV. Ausfahrt
Kapitel XIVAusfahrt
Making of
Making of: So entstanden die Hafen-Bilder
Der italienische Fotograf Luca Locatelli wurde für seine Fotos von technischen Großanlagen vielfach ausgezeichnet. Wie er den Hamburger Hafen ins Bild setzte, sehen Sie in diesem Video.
Credits
Credits
Peter-Matthias Gaede
Fotos
Sämtliche Bilder stammen von Luca Locatelli
(Ausnahmen: Startseite Kapitel VI, Oliver Rohé; Kapitel XI & XII, Malte Joost; Kapitel XIII, imago images/blickwinkel; Startseite Kapitel XIV, Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images)
Infografik
Tim Wehrmann
Videos
Luca Locatelli (Drohnenvideos)
Roman Pawlofski (Making of)
Multimedia-Umsetzung
Jan Henne




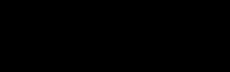



































 An den Schalthebeln der Fracht
An den Schalthebeln der Fracht
 Kapitelübersicht
Kapitelübersicht
 Ein Schiff wird kommen
Ein Schiff wird kommen
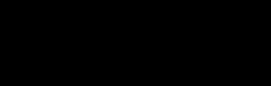
 Infografik: Hamburger Hafen
Infografik: Hamburger Hafen

 Container
Container



 In der Wärmestube
In der Wärmestube


 Am Dirigentenpult
Am Dirigentenpult

 Die Abfangjäger
Die Abfangjäger

 Die Saubermänner
Die Saubermänner

 Im Tunnel
Im Tunnel

 Erschütterungen ganz oben
Erschütterungen ganz oben


 Die Unsichtbaren
Die Unsichtbaren

 Der Schlepper
Der Schlepper

 Nostalgie
Nostalgie

 Die Manager
Die Manager

 Der Endemit
Der Endemit
 Ausfahrt
Ausfahrt



 Making of: So entstanden die Hafen-Bilder
Making of: So entstanden die Hafen-Bilder
 Credits
Credits